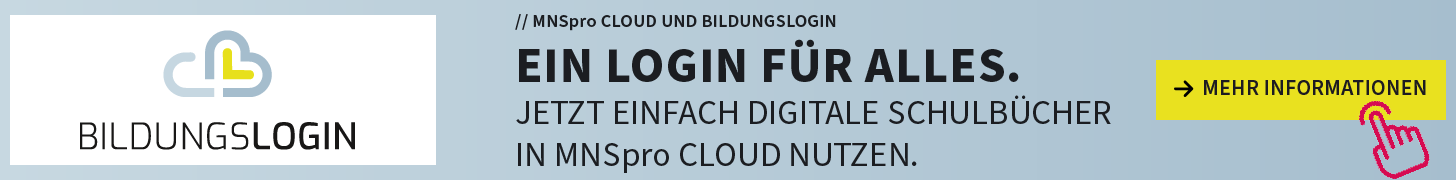Computerspiele im Unterricht können den Lernprozess unterstützen sowie die Gestaltungskompetenz und die Kommunikationsfähigkeit der Lernenden anregen – davon zeigen sich Stefanie Nickel, Vertretungsprofessorin für Erziehungswissenschaft/ Grundschulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, und Medienpädagoge Daniel Autenrieth überzeugt. Beide forschen gemeinsam zum Thema „Game-based Learning“. Im Fokus dabei: die Möglichkeiten, die digitale Spiele bieten, um forschend-entdeckendes Lernen umzusetzen sowie Kollaboration und Partizipation zu fördern. Über die Potenziale des Game-based Learning, die Voraussetzungen und die Umsetzung im Unterricht sprachen sie mit Einfach.Digital.Lernen.
Einfach.Digital.Lernen.: Welche Vorteile bietet das Konzept „Game-based Learning“ für den Lehr-Lernprozess?
Stefanie Nickel: Neben dem Aspekt der Motivation – Computerspiele kommen ja aus der Lebenswelt der Kinder – ermöglicht Game-based Learning Partizipation. In Anlehnung an Roger Hart verstehen wir unter Partizipation, dass Menschen ihre eigenen Ideen einbringen können, um Gestaltungskompetenz anzubahnen.
Daniel Autenrieth: Man muss allerdings vorsichtig mit dem Begriff „Motivation“ sein, weil man sonst schnell bei der Taktik „chocolate covered broccoli“ ist, bei der der Lerninhalt in irgendeiner Form mit Spielen behandelt wird, also im übertragenen Sinne bloß mit Schokolade überzogen wird. Dann haben wir im Prinzip zwar extrinsische Motivatoren, die führen aber nicht zu einer intrinsischen Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, sich tatsächlich mit den Inhalten auseinanderzusetzen.
Aber noch mal zur Frage, welche Vorteile Game-based Learning bietet: Aus unserer Sicht sind mit Gaming und Game-Design besonders drei Potenziale verbunden: zum einen die Visualisierung von Ideen. Wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel an einem Projekt, in dem es um Zukunftsgestaltung geht: Wie sieht beispielsweise die Traumschule aus oder das Bildungssystem der Zukunft? Digitale Spiele helfen dabei, diese Ideen zu visualisieren. Und durch unsere Forschung haben wir in den vergangenen Jahren zeigen können, dass Gaming und Game-Design kreatives und kommunikatives Handeln aktivieren, zwei der zentralen Zukunftskompetenzen.
EDL: Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, sowohl mit Blick auf das Alter der Schüler*innen als auch auf die Ressourcen, damit Lehrkräfte realistisch erwarten können, dass die erwähnten Vorteile und Potenziale zum Tragen kommen?

Nickel: Wir haben bereits mit ersten Klassen zusammengearbeitet, mit Fünf- bis Sechsjährigen. Das war eine Art Tablet-Klasse. Das heißt, ihnen standen iPads zur Verfügung. Das ist natürlich nicht verkehrt, wenn die notwendigen Endgeräte vorhanden sind und wenn es WLAN an der Schule gibt. Mit Blick auf die Lehrerinnen und Lehrer sollte eine gewisse Affinität zu Spielen vorhanden sein. Sie sollten das Spiel schon einmal gespielt haben, bevor sie es einsetzen, damit sie wissen, was sie erwartet und welche Probleme eventuell auftauchen können.
Autenrieth: Wobei der Aspekt der technischen Ausstattung nicht mal so stark im Vordergrund stehen muss. Game-based Learning ist auch möglich, ohne dass High-End-Geräte zur Verfügung stehen oder eine Eins-zu-eins-Ausstattung mit Tablets vorhanden ist. Wir haben letztes Jahr beispielsweise im Zuge des Projekts eSwäG, Escape Schwäbisch Gmünd, Escape-Rooms zur Stadt Schwäbisch Gmünd unter anderem mit Schüler*innen entwickelt, für die viel Konzeptionsarbeit notwendig war. Da musste der Ort besucht werden, um den es im Spiel gehen sollte, und es mussten Spiel-Stories geschrieben werden. Dazu reicht im Prinzip die einfachste Ausstattung. Durch die Auswahl geeigneter Software, die kostenlos und nicht so ressourcenhungrig ist, lässt sich auch mit älteren Endgeräten arbeiten. Minetest ist zum Beispiel ein freies Open-World-Spiel, in der die Spieler die aus Blöcken bestehende Spielwelt nach Belieben gestalten können; Twine ist eine simple webbasierte Oberfläche, um interaktive Geschichten zu schreiben. Das heißt, das Budget einer Schule stellt nicht zwangsläufig eine Hürde dar.
Unabhängig von Alter und Ressourcen ist ein möglichst hoher Partizipationsgrad eine weitere Voraussetzung. Es geht nicht darum, die Spiele einfach zu spielen, sondern sie mitzugestalten. Viele Spiele sind so entwickelt worden, dass sie veränderbar sind, dass nicht nur die vorgegebene Storyline durchgespielt werden kann, sondern dass Spieler*innen selbst aktiv zu Gestalter*innen werden können, selbst Welten aufbauen können. Die Forschung zeigt, dass sich die Partizipationserfahrungen, die man dabei macht, auf Gesellschaft und auf die Gestaltung der realen Welt übertragen können. Ein Beispiel für ein solches Spiel ist das bereits erwähnte Minetest. Die Escape-Rooms des Projekts eSwäG wie „Der Dieb im Museum im Prediger“, „Der verlorene Apfel“, „Hexenjagd in Schwäbisch Gmünd“, „Königstor“ sind beispielsweise innerhalb einer Minetest-Welt entstanden und nun über den Minetest-Server frei zugänglich.
Nickel: Wie Herr Autenrieth schon erwähnt hat: Für die Online Escape-Rooms haben die Gruppen die kulturellen Orte, die sie mit Minetest nachbauen wollten, vorab erkundet und sich für die Spiel-Stories mit der historisch kulturellen Stadtgeschichte auseinandergesetzt. Sie haben sich mit Spielemechanismen beschäftigt und Rätsel entwickelt. Wirklich vieles geschieht also analog, bevor es zur Gestaltung im virtuellen Raum kommt. Der Aspekt der Partizipation ist uns dabei so wichtig, weil in dem Moment, in dem die Kinder und Jugendlichen selbst tätig werden, sind sie Teil des Prozesses und haben einen anderen Bezug dazu.
Im Prinzip ist es eine Frage der Fantasie, wie sich ein Inhalt im Unterricht medial aufarbeiten lässt.
Daniel Autenrieth, Medienpädagoge
EDL: Sie haben bereits einige Spiele erwähnt, die sich für Game-based Learning eignen. Wodurch zeichnen sich diese aus?
Autenrieth: Relativ zentral sind drei Prinzipien: Low Floor, High Ceiling, Wide Walls. Low Floor bedeutet, dass das Spiel einen sehr einfachen Zugang bietet. Bei Minetest beispielsweise kann ich einfach anfangen und mit ein paar Blöcken eine Wiese bauen oder direkt ein ganzes Haus und kann diese Blöcke ebenso leicht wieder entfernen. Der Begriff „High Ceiling“ steht für das große Potenzial, das in einem Spiel steckt, für die Komplexität, die es bietet. Wieder das Beispiel Minetest: Hier kann ich riesige, miteinander verschachtelte Räume bauen und Aktionen programmieren. Das dritte Prinzip, „Wide Walls“, steht für die vielfältigen Möglichkeiten, wie ein Spiel genutzt werden kann. Mit Minetest lassen sich nicht nur Escape-Rooms gestalten, sondern, wie erwähnt, auch Utopien visualisieren. Es gibt noch zahlreiche andere Tools, die diese Voraussetzungen erfüllen, wie CoSpaces, Lego Mindstorms oder die Programmiersprache Scratch, mit der ich ebenfalls Spiele entwickeln kann.
EDL: Welche Unterrichtsfächer eignen sich für diese Art des Lernens?
Autenrieth: Alle. (lacht) Das Vorgehen entspricht einer aktiven Medienarbeit und die Anbahnung von Medienkompetenz soll ja grundsätzlich als Querschnittsaufgabe von allen Fächern wahrgenommen werden. Die aktive Medienarbeit ist der Königsweg der Medienpädagogik, weil ich dabei ein Handeln mit Medien, über Medien und durch Medien habe. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich aktiv mit Medien auseinander, um ein Medienprodukt zu schaffen. Egal ob es sich um ein Video, ein Hörspiel eine Bildergeschichte, einen Comic oder ein Spiel handelt, die Produktion geschieht in einem Kontext, die Schüler*innen beschäftigen sich für den Inhalt des Medienprodukts mit einem Thema. Dieses kann von einer Darstellung von Faust über den Lebensraum des Igels, bis zur Frage, wie ich komplexe Integrale lösen kann, reichen. Im Prinzip ist es mehr eine Frage der Fantasie, wie sich ein Inhalt im Unterricht medial aufarbeiten lässt.

EDL: Worauf sollten Lehrkräfte bei der Umsetzung im Unterricht achten?
Nickel: Ich denke, hauptsächlich auf die Vorerfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche ihrer Schülerinnen und Schüler. Das ist das Wesentliche; und sie sollten ihnen möglichst viel Freiraum bieten, damit sie gestalterisch tätig werden können.
Autenrieth: Ich möchte auch noch auf Mitchel Resnick und seinen 4P-Ansatz verweisen. 4P steht als Abkürzung für Project, Peers, Passion und Play. Das heißt, projektbasiertes Arbeiten eignet sich hervorragend für dieses Lernformat. Es sollte zudem eine spielerische Herangehensweise gewährleistet sein, die Fehler zulässt, die zulässt, dass sich die Schülerinnen und Schüle überhaupt kreativ ausleben können, egal ob in der Gestaltung oder der Ideenentwicklung. Es braucht Passion, zum Beispiel durch Themen, die an die Lebenswelt und die Interessen der Kinder und Jugendlichen anschlussfähig sind. Und die Zusammenarbeit mit Peers ergibt sich in der Schule quasi automatisch, wenn die Schülerinnen und Schüler mit Gleichgesinnten an einem Projekt arbeiten.
EDL: Was empfehlen Sie interessierten Lehrkräften, die diese Art des Unterrichtens ausprobieren wollen, sich aber vielleicht unsicher fühlen?
Nickel: Wir haben Unterrichtskonzepte zum Thema „Games im Unterricht“ erarbeitet, die entsprechend beschreiben, wie man vorgehen kann. Ich glaube, die lassen sich für den Einstieg gut nutzen (demnächst hier verfügbar; Anm. d. Red.).
Autenrieth: Das glaube ich auch und ich glaube, man muss es ausprobieren, also das Spiel, das man einsetzen möchte. Wenn ich das Spiel selbst gespielt habe, bekomme ich ein Gefühl dafür, was möglich ist und gewinne Sicherheit, die Software einzusetzen. Selbst wenn es mal nur eine halbe Stunde ist. Und dann kann man das Lernformat mal in einer Projektwoche oder zum Abschluss des Schuljahrs ausprobieren, um erste Erfahrungen zu sammeln, die dann den Einsatz im regulären Unterricht erleichtern.