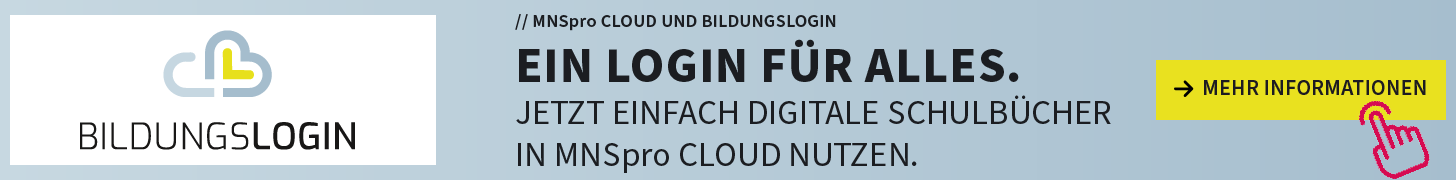DÜSSELDORF. Schulunterricht in Videokonferenzen? Das hätte sich vor dem ersten Corona-bedingten Lockdown im Jahr 2020 niemand vorstellen können. Viele Schulen mussten von einem Tag auf den anderen improvisieren. Mittlerweile ist das digitale Lernen in vielen Schulen zum Alltag geworden. Bisher war der digitale Unterricht allerdings nicht gesetzlich verankert. Dies hat sich nun geändert, zumindest in Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland. Dort gehört jetzt die Vermittlung digitaler Kompetenzen zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen. Vielleicht gut gemeint – aber schlecht gemacht, so kritisieren die oppositionellen Grünen. Sie untermauern das mit einem Rechtsgutachten.
Am 16. Februar wurde im Düsseldorfer Landtag ein neues Schulrechtsänderungsgesetz mit den Stimmen der Koalition aus CDU und FDP verabschiedet. „Damit wird schulgesetzlich klargestellt, dass es zu den wichtigsten Aufgaben von Schule gehört, Schülerinnen und Schüler auf die digitalen Herausforderungen vorzubereiten“, so erklärt Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) laut Pressemitteilung.
Die Opposition stimmte dagegen. Vor allem die Grünen äußern Kritik an der neuen Schulrechtsänderung. Das Gesetz erfülle nicht die Anforderungen an das moderne Schulleben, so erklärt Sigrid Beer, bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion – es sei nicht verfassungskonform. Die Grünen hatten ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes in Auftrag gegeben, in dem sie ihre Kritik zum neuen Schulrechtsänderungsgesetz äußern. Das Gutachten führt an, dass die Gesetzesnovellierung nicht verfassungskonform sei und die Voraussetzungen für den digitalen Unterricht nicht ausreichend geregelt seien. Dies betreffe vor allem die technische Ausstattung der Schüler*innen.
Die Eltern sind nur für den persönlichen Ausstattungsbedarf der Schüler*innen zuständig. Dazu gehören beispielsweise Hefte, Zeichenblöcke etc. Es sei unklar, ob die Ausstattung für den digitalen Unterricht auch zum persönlichen Ausstattungsbedarf gehöre und daher von den Eltern angeschafft werden muss. Man könne nicht voraussetzen, dass alle Schüler*innen entsprechende Endgeräte wie Laptops etc. zu Hause zur Verfügung hätten. Verpflichtender digitaler Unterricht bedeute nicht nur die Ausstattung mit entsprechender Hardware, sondern auch mit Software. Auch müssten im häuslichen Umfeld der Schüler*innen entsprechende Lernräume und ein Internetzugang vorhanden sein. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten und leistungsstarkem Internet bedeute aber für einkommensschwache Familien einen erheblichen finanziellen Aufwand und stelle damit für die Kinder und Jugendlichen eine Zugangshürde zum staatlichen Bildungsangebot dar. „Es muss laut Gutachter sichergestellt sein, dass den Eltern die Anschaffung entsprechender digitaler Geräte und die Bereitstellung des notwendigen Internetanschlusses überhaupt zumutbar ist“, sagt Beer.
Dadurch sei das Recht auf gleiche Teilhabe an schulischer Bildung berührt. Deshalb müssen Familien aus einkommensschwachen Schichten eine angemessene staatliche Unterstützung erhalten. In einem solchen Falle müsse der Staat für die entsprechende digitale Ausstattung der Schüler*innen sorgen. Dies gelte auch, wenn der digitale Unterricht nicht verpflichtend, sondern nur optional angeboten wird, denn das Recht auf schulische Bildung garantiert gleiche Teilhabe für alle Schüler*innen. Wenn keine privaten Endgeräte vorhanden seien, müsse die Schule eigene Geräte mit geeigneter Software zur Verfügung stellen, die die Schüler*innen nutzen, so das Gutachten. Dies sei aber bisher rechtlich nicht festgelegt. Auch die Eltern seien bis dato vom Gesetzgeber nicht dazu verpflichtet, für die entsprechenden Endgeräte zu sorgen. Auch müsse die Schule ihren Schüler*innen entsprechende Lernräume zur Verfügung stellen.
Das Gutachten führt außerdem an, dass aus der Gesetzesnovelle nicht hervorginge, wer in den Schulen über den Einsatz neuer Software entscheidet. Meist würde diese Entscheidung von der Lehrerkonferenz an den einzelnen Schulen getroffen. Hier müsse es eine klare Zuweisung der Zuständigkeiten geben. Das Gutachten beanstandet zudem, dass sich die Regelungen zum digitalen Unterricht ausschließlich auf den Distanzunterricht in der Pandemie beziehen. Bis zum 31. Juli 2022 ist der Distanzunterricht gesetzlich verankert. Dem Gutachten zufolge müsse digitaler Unterricht jedoch näher definiert werden und dem allgemeinen Bildungsanspruch Rechnung tragen. „Offenbar sind die bisherigen Regelungen nur für die Pandemie gedacht und verfehlen die grundlegenden Anforderungen für das Lernen und den Bildungsanspruch aller Schülerinnen und Schüler“, erklärt Beer.
Des weiteren führt das Gutachten aus, dass digitaler Unterricht aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten einer Einwilligung oder einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Diese gäbe es bisher noch nicht. Wird ein externer Dienstleister beauftragt, muss dieser zur Einhaltung der allgemeinen Datenschutzbestimmungen verpflichtet werden. Auch soll laut Gutachten für den Digitalunterricht datensparsame Software eingesetzt werden. Es sei zu prüfen, welche personenbezogenen Daten der Schüler*innen für die Durchführung des Unterrichts benötigt werden. Wichtig hierbei sei auch das jeweilige Unterrichtsfach und das Alter der Schüler*innen. Für den Datenschutz im digitalen Unterricht sei die jeweilige Schule durch die Schulleitung als auch das Ministerium für Bildung zuständig. Dafür müsse das Personal über entsprechende rechtliche und technische Kenntnisse verfügen, um die Aufsicht über den Datenverarbeitungsprozess zu gewährleisten. Den Schulen sollen Datenschutzbeauftragte zur Seite gestellt werden, die z. B. die Schulleitung im operativen Geschäft unterstützen.
Alles in allem, so Beer, lasse die Landesregierung die Schulen bei Fragen zu digitalem Unterricht weiter allein. „Es liegt in der Verantwortung des Staates, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Kindern und Jugendlichen diese digitale Souveränität zu ermöglichen. Hier hat Schulministerin Gebauer sowohl handwerklich als auch inhaltlich ihren Job schlecht gemacht.“ Agentur für Bildungsjournalismus